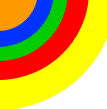Die Physik der Farben
Inhalt
1. Entstehung von Farben
2. Goethes Farbenlehre
3. Additive und subtraktive Farbmischung
Teil 1: Entstehung von Farben (frank)
Um die Physik der Farben zu verstehen muss man erst erklären wie die Farben
entstehen. Um zu Erklären wie Farben entstehen, benötigen wir das bor`sche
Atommodell.
Das Model ist wie folgt aufgebaut. Man hat ein Proton in der Mitte. Um dieses
Proton kreist auf einer Bahn ein
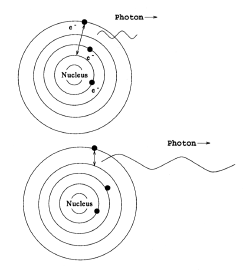
Elektron. Nun kann es vorkommen, dass ein Elektron durch Energie von außerhalb angeregt wird und auf eine höhere Bahn des Atoms springt. Da sich das Elektron dort aber nicht wohl fühlt springt es nach kurzer Zeit auf seine Normale Bahn zurück Dabei wird Energie in form von Energiepäckchen frei. Dieses Päckchen nennen wir Photon. Jedes Photon hat nun seine eigene Wellenlänge. Diese Wellenlänge nimmt nun das menschliche Auge zum Teil als Farbe wahr.
Manche Wellenlängen sind aber auch zu kurz oder zu Lang . Diese kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen.
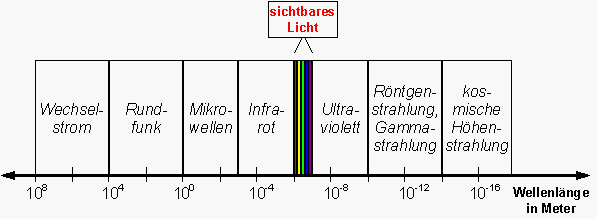
Doch nun wieder zur Physik der Farben. Wir sind bei den farbigen
Wellenlängen, die auf dem Weg zur Erde sind. Diese Wellenlängen kommen nun in
Form von Licht auf die Erde. Nun wird sich jeder Fragen, wie dass möglich ist
denn schließlich hat sichtbares Licht keine Farbe.
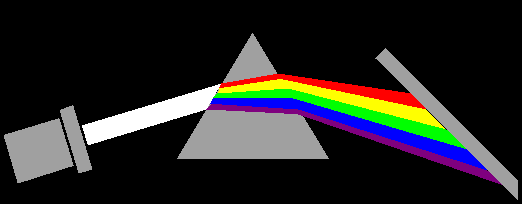 Um
dies zu erklären ziehen wir Sir Isaac Newton zu rate. Dieser nahm während seiner
Forschungen über das Licht ein Prisma und brach durch dieses das Licht. Dabei
erkannte er, das im Licht alle bekannten Farben vertreten wahren. Diese
Erkenntnis brachte Newton darauf, dass alle Farben kombiniert sichtbares Licht
ergab, das wir Wahrnehmen.
Um
dies zu erklären ziehen wir Sir Isaac Newton zu rate. Dieser nahm während seiner
Forschungen über das Licht ein Prisma und brach durch dieses das Licht. Dabei
erkannte er, das im Licht alle bekannten Farben vertreten wahren. Diese
Erkenntnis brachte Newton darauf, dass alle Farben kombiniert sichtbares Licht
ergab, das wir Wahrnehmen.
Mit Hilfe dieser dieser Erkenntnis nun entwickelte Newton bis 1704 ein
Farbspektrum, das bis heute seine Gültigkeit hat. Es besagt, dass unser
 sichtbares
Licht in einem Wellenlängenbereich von ca. 700 - 400 Nanometern
( 10-9 ) liegt. Dabei liegt der blau/ violette Lichtanteil in
kurzwelligen Bereichen von ca.400 - 500 Nanometern und der rote Lichtanteil in
langwelligen Bereichen von 700 - 650 Nanometern. Dazwischen liegen von kurz nach
Langwellig grün, gelb und dann orange. Damit gelang Newton etwas revolutionäres,
da keiner sich zuvor Erklären konnte, wo Farben herkommen. Die ganze
Farbenforschung wäre ohne Newton also nie so zustande gekommen, auch wenn manche
Menschen seinem Farbsystem nicht zustimmten. Doch dazu kommen wir an einer
anderen Stelle dieses Referates. Wir wollen uns im Moment mit der Erkenntnis
begnügen das Newton herausfand das im Sichtbaren Licht alle Farben vorhanden
sind.
sichtbares
Licht in einem Wellenlängenbereich von ca. 700 - 400 Nanometern
( 10-9 ) liegt. Dabei liegt der blau/ violette Lichtanteil in
kurzwelligen Bereichen von ca.400 - 500 Nanometern und der rote Lichtanteil in
langwelligen Bereichen von 700 - 650 Nanometern. Dazwischen liegen von kurz nach
Langwellig grün, gelb und dann orange. Damit gelang Newton etwas revolutionäres,
da keiner sich zuvor Erklären konnte, wo Farben herkommen. Die ganze
Farbenforschung wäre ohne Newton also nie so zustande gekommen, auch wenn manche
Menschen seinem Farbsystem nicht zustimmten. Doch dazu kommen wir an einer
anderen Stelle dieses Referates. Wir wollen uns im Moment mit der Erkenntnis
begnügen das Newton herausfand das im Sichtbaren Licht alle Farben vorhanden
sind.
Doch nun zurück zu unserem Licht das gerade auf die Erde trifft. Das Licht
ereicht als Erstes die Atmosphäre.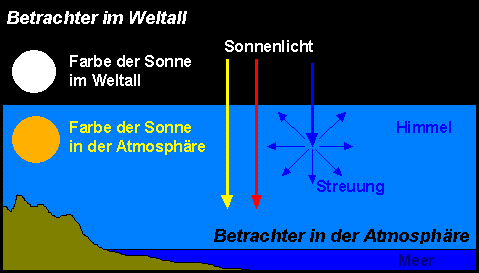 Dort wird der kurzwellige Teil des Lichtes, also der Blaue Anteil gestreut.
Dadurch erscheint uns der Himmel blau wenn wir ihn uns bei klarem Wetter
anschauen. Diese Streuung hat aber noch einen weiteren Effekt. Während ein
Astronaut im Weltall die Sonne als weißen Punkt wahrnähme, sehen wir die Sonne
gelb. Das liegt an der Streuung des blauen Lichtanteils in der Atmosphäre.
Dadurch verliert das Licht an Kurzwellen , sodass es uns immer noch farblos
erscheint, die Sonne hingegen für uns auf der Erde gelblich scheint und nicht
wie in Wirklichkeit weiß. Doch wie sieht unser Auge Farbe überhaupt. Um dies zu
klären benötigen wir einen kleine Exkurs in die Biologie
Dort wird der kurzwellige Teil des Lichtes, also der Blaue Anteil gestreut.
Dadurch erscheint uns der Himmel blau wenn wir ihn uns bei klarem Wetter
anschauen. Diese Streuung hat aber noch einen weiteren Effekt. Während ein
Astronaut im Weltall die Sonne als weißen Punkt wahrnähme, sehen wir die Sonne
gelb. Das liegt an der Streuung des blauen Lichtanteils in der Atmosphäre.
Dadurch verliert das Licht an Kurzwellen , sodass es uns immer noch farblos
erscheint, die Sonne hingegen für uns auf der Erde gelblich scheint und nicht
wie in Wirklichkeit weiß. Doch wie sieht unser Auge Farbe überhaupt. Um dies zu
klären benötigen wir einen kleine Exkurs in die Biologie
Das Menschliche Auge ist wie folgt aufgebaut. Als erstes die Hornhaut, die
das Auge vor Umwelteinflüssen wie Schmutz zum Teil schütz.
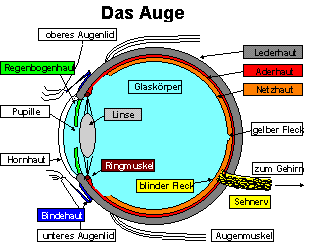 Hinter
der Hornhaut befindet sich die Pupille. Diese öffnet und schließt sich je nach
Lichtintensität. Durch die dahinter gelegene Linse wird das gesehene Bild auf
dem Kopf stehen auf die Netzhaut geworfen. Die Netzhaut wandelt das Bild nun in
elektrische Signale um und sendet diese zu Gehirn. Dies geschieht am so
genannten blinden Fleck, an dem wir nichts sehen können, da dort der Sehnerv
liegt, der die elektrischen Impulse zum Gehirn sendet. Der Punkt im Auge an dem
wir am besten sehen
Hinter
der Hornhaut befindet sich die Pupille. Diese öffnet und schließt sich je nach
Lichtintensität. Durch die dahinter gelegene Linse wird das gesehene Bild auf
dem Kopf stehen auf die Netzhaut geworfen. Die Netzhaut wandelt das Bild nun in
elektrische Signale um und sendet diese zu Gehirn. Dies geschieht am so
genannten blinden Fleck, an dem wir nichts sehen können, da dort der Sehnerv
liegt, der die elektrischen Impulse zum Gehirn sendet. Der Punkt im Auge an dem
wir am besten sehen 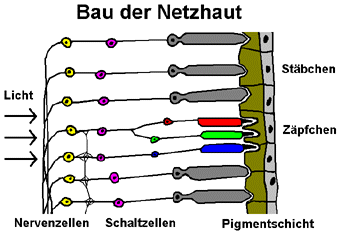 können ist der gelbe Fleck.
Damit
laufen alle Sehvorgänge auf der Netzhaut ab. Aber wie sieht die Netzhaut aus.
Sie besteht zwei verschiedenen Teilen von Nervenzellen, aus Stäbchen und
Zäpfchen. Die Stäbchen sind im Auge für die hell dunkel Kontraste zuständig und
haben so mit dem Sehen von Farben nichts zu tun. Die Zäpfchen hingegen reagieren
nun auf drei bestimmte Wellenlängen des Lichts.
können ist der gelbe Fleck.
Damit
laufen alle Sehvorgänge auf der Netzhaut ab. Aber wie sieht die Netzhaut aus.
Sie besteht zwei verschiedenen Teilen von Nervenzellen, aus Stäbchen und
Zäpfchen. Die Stäbchen sind im Auge für die hell dunkel Kontraste zuständig und
haben so mit dem Sehen von Farben nichts zu tun. Die Zäpfchen hingegen reagieren
nun auf drei bestimmte Wellenlängen des Lichts.
1. rotempfindliche, langwellig empfindliche (L-Zapfen)2. grünempfindliche, mittelwellig empfindliche (M-Zapfen)
3. blauempfindliche, kurzwellig empfindliche (K-Zapfen)
Diese drei Zäpfchen machen nun auf Grundlage der additiven Farbmischung,
die wir später noch näher erläutern werden, jede Farbe sehbar für den Menschen. 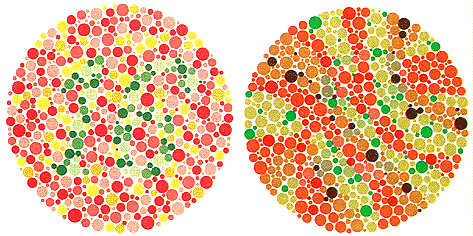 Bei
Manchen Menschen kann es aber auch zu Störungen oder Ausfall eines Zäpfchens
kommen. Der Mensch wird dann Farbenblind. Wenn zum Beispiel der L-Zapfen bei
einem Menschen ausfällt wird er rot - grün farbenblind. Er erkennt dann auf dem
nebenstehenden Bildern, auf der linken Seite keine Zahl und auf der Rechten
Seite eine zwei. Bei Normal sehenden Menschen ist dies genau anders. Sie sehen
auf der Linken Seite eine 16 und auf der rechten Seite gar keine Zahl. So sieht
das menschliche Auge also Farben. Doch nun verlassen wir wieder die Biologie und
kehren zurück zur Physik.
Bei
Manchen Menschen kann es aber auch zu Störungen oder Ausfall eines Zäpfchens
kommen. Der Mensch wird dann Farbenblind. Wenn zum Beispiel der L-Zapfen bei
einem Menschen ausfällt wird er rot - grün farbenblind. Er erkennt dann auf dem
nebenstehenden Bildern, auf der linken Seite keine Zahl und auf der Rechten
Seite eine zwei. Bei Normal sehenden Menschen ist dies genau anders. Sie sehen
auf der Linken Seite eine 16 und auf der rechten Seite gar keine Zahl. So sieht
das menschliche Auge also Farben. Doch nun verlassen wir wieder die Biologie und
kehren zurück zur Physik.
Da wir nun Wissen wie wir Farben sehen, kommen wir nun zu dem Aspekt wie aus
dem sichtbaren, aber doch farblo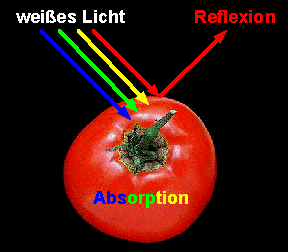 sem
Licht, Farbe entsteht. Dies wollen wir am Beispiel einer Tomate verdeutlichen.
Wenn das farblose sichtbare Licht auf die Erde kommt, trifft es auf die Tomate.
Die Tomate nun absorbiert aus dem Licht die Farbanteile blau, grün und gelb. Der
rote Farbanteil des Lichtes jedoch wird von der Tomate reflektiert und trifft
auf die Netzhaut unseres Auges. Dieses nimmt dann die Tomate als rote Frucht
war. Wenn man nun also die Tomate mit Licht bestrahlen würde dass keinen roten
Farbanteil hat, wie zum Beispiel fluoreszierendes Licht, das bekanntlich nur
Blauanteile besitz, erschiene dem menschlichem Auge die Tomate schwarz, da der
blaue Lichtanteil von ihr absorbiert wäre. So ist das Prinzip bei allen Farben
die wir sehen, ein bestimmter Anteil des Lichtes wird von einem Gegenstand
absorbiert, Die Farbanteile die dann noch übrig sind, vermischen sich in unserem
Gehirn dann zu einer Farbe, wie zum Beispiel rot grün oder blau.
sem
Licht, Farbe entsteht. Dies wollen wir am Beispiel einer Tomate verdeutlichen.
Wenn das farblose sichtbare Licht auf die Erde kommt, trifft es auf die Tomate.
Die Tomate nun absorbiert aus dem Licht die Farbanteile blau, grün und gelb. Der
rote Farbanteil des Lichtes jedoch wird von der Tomate reflektiert und trifft
auf die Netzhaut unseres Auges. Dieses nimmt dann die Tomate als rote Frucht
war. Wenn man nun also die Tomate mit Licht bestrahlen würde dass keinen roten
Farbanteil hat, wie zum Beispiel fluoreszierendes Licht, das bekanntlich nur
Blauanteile besitz, erschiene dem menschlichem Auge die Tomate schwarz, da der
blaue Lichtanteil von ihr absorbiert wäre. So ist das Prinzip bei allen Farben
die wir sehen, ein bestimmter Anteil des Lichtes wird von einem Gegenstand
absorbiert, Die Farbanteile die dann noch übrig sind, vermischen sich in unserem
Gehirn dann zu einer Farbe, wie zum Beispiel rot grün oder blau.
Damit endet der Teil der Physikalischen Erklärung über die Entstehung von Farben. Als nächstes wollen wir uns mit den unterschiedlichen Farbtheorien befassen, warum es sie gibt und wieso sie alle ihre Gültigkeit haben.
Goethes Farbenlehre

Biografie
Goethe Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28.August 1749 in Frankfurt am Main
als Sohn des Kaiserlichen Rater Dr. Johann Caspar Goethe und Catharina Elisabeth
geboren. Seine Eltern , legten sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung , aus
diesem Grund bekam Goethe schon in jungen Jahren Privatunterricht in Latein,
Griechisch, Englisch, Italienisch und Schönschreiben . Ein Jahr später , wurde
seine Schwester Cornelia zur Welt gebracht . 1765 machte er ein Jurastudium an
der Universität in Leipzig . Im Sommer 1768 erlitt er einen Blutsturz, im
Winter gleichen Jahres ersuchte ihn eine lebensgefährliche Krankheit , die er
aber gut überstand .1770 wechselte er die Universität und ging nach Straßburg
.Dennoch lag sein Interesse weniger im juristischen Bereich, vielmehr besuchte
er in erster Linie medizinische Vorlesungen. 1771 promovierte er zum Lizentiaten
der Rechte und zog anschließend nach Frankfurt, wo er als Rechtsanwalt
zugelassen wurde. Im April 1775 verlobte er sich mit Lili Schönemann, doch nach
nur einem halben Jahr trennte er sich von ihr wieder . Zwei Jahre nach dem Tod
seiner Schwester 1777 , wurde er zum Geheimrat ernannt . 1782 wurde Goethe von
Kaiser Joseph dem II. in den Adelsstand erhoben , nur einen Monat später starb
sein Vater. Im März 1784 entdeckte Goethe in Jena den Zwischenkieferknochen am
menschlichen Obergebiss . Im September 1788 trafen sich Goethe und Schiller zum
ersten mal in Rudolstadt .Ein Jahr später wurde sein Sohn Julius August Walther
geboren, vier Jahre später folgte die Tochter Caroline, die jedoch schon in
frühen Alter starb . Im März  1790 ist Goethe zu seiner zweiten Reise nach
Venedig , von der er im Juni nach Weimar zurück kehrte . 1801 erkrankte er an
einer Gesichtsrose. 1803 wurde seine Tochter Kathinka geboren , doch wie seine
erste Tochter lebte auch sein drittes Kind nur kurze Zeit. 1804 ernannte man ihn
zum Wirklichen Geheimen Rat . Im folgenden Jahr machte ihm mehrmals eine
Nierenkolik sehr zu schaffen.
1790 ist Goethe zu seiner zweiten Reise nach
Venedig , von der er im Juni nach Weimar zurück kehrte . 1801 erkrankte er an
einer Gesichtsrose. 1803 wurde seine Tochter Kathinka geboren , doch wie seine
erste Tochter lebte auch sein drittes Kind nur kurze Zeit. 1804 ernannte man ihn
zum Wirklichen Geheimen Rat . Im folgenden Jahr machte ihm mehrmals eine
Nierenkolik sehr zu schaffen.
Am 19 .Oktober 1806 heiratete er Christiane Vulpius.
1808 starb Goethes Mutter. Im Dezember 1815 wurde er zum Staatsminister ernannt. Ein halbes Jahr später starb seine Frau Christiane nach schwerer Krankheit. Er selbst erkrankte 1823 an einer Herzbeutel- und Rippenfellentzündung. Im Oktober 1830 starb sein Sohn August, Goethe erlitt nur einen Monat später einen erneuten Blutsturz. Am 22.März 1832 starb Goethe nach einwöchiger Krankheit.
Goethes Farbenlehre
Die Farbenlehre Goethes entstand im Zeitraum
 von 1790 bis 1810 . Den Anfang von Goethes Beschäftigung mit den
Farberscheinungen , machte der Aufstieg zum Brocken im Harz , bei dem er
verschieden farbige Schatten beobachten konnte . Das Werk der Farbenlehre
basierte auf diesen Beobachtungen und stellte die Grundlage zur Erschaffung . Es
beinhaltete die Wirkung von Farben auf den Menschen . Seine Beiträge zur Optik
machte er 1791 , in denen er durch ein Prisma hell und dunkel Kontraste
beobachtete und die Aufbrechung des Lichtes in verschiedene Farbteile
feststellte . Er beschreibt nicht nur die optische Täuschung eines
Kreisdurchmessers auf verschieden farbigen Hintergründen der hell-dunkel
Kontraste , sondern auch die farbigen Begleiterscheinungen der Schatten und
Kontraste , denen er nun die größte Aufmerksamkeit schenkte und deswegen seine
Beiträge zur Optik nicht fortsetzte . Von nun an beschäftigte er sich mehr und
mehr mit der eigentlichen Farbenlehre , das Resultat ist der bekannte , aber
noch weiter bearbeitete Farbkreis von Goethe . Nach Goethe wird im Auge durch das Sonnenlicht ein eigenes Licht erzeugt , das
dann dem Gehirn ein Bild übermittelt . Dazu auch das folgende Kurgedicht :
von 1790 bis 1810 . Den Anfang von Goethes Beschäftigung mit den
Farberscheinungen , machte der Aufstieg zum Brocken im Harz , bei dem er
verschieden farbige Schatten beobachten konnte . Das Werk der Farbenlehre
basierte auf diesen Beobachtungen und stellte die Grundlage zur Erschaffung . Es
beinhaltete die Wirkung von Farben auf den Menschen . Seine Beiträge zur Optik
machte er 1791 , in denen er durch ein Prisma hell und dunkel Kontraste
beobachtete und die Aufbrechung des Lichtes in verschiedene Farbteile
feststellte . Er beschreibt nicht nur die optische Täuschung eines
Kreisdurchmessers auf verschieden farbigen Hintergründen der hell-dunkel
Kontraste , sondern auch die farbigen Begleiterscheinungen der Schatten und
Kontraste , denen er nun die größte Aufmerksamkeit schenkte und deswegen seine
Beiträge zur Optik nicht fortsetzte . Von nun an beschäftigte er sich mehr und
mehr mit der eigentlichen Farbenlehre , das Resultat ist der bekannte , aber
noch weiter bearbeitete Farbkreis von Goethe . Nach Goethe wird im Auge durch das Sonnenlicht ein eigenes Licht erzeugt , das
dann dem Gehirn ein Bild übermittelt . Dazu auch das folgende Kurgedicht :
"Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das Licht erblicken?
Lebt' nicht in uns Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?"
Die Farberscheinungen kann man in eine Reihenfolge bringen , wobei die Farbe Gelb dem Licht und Blau der Dunkelheit am nächsten ist . Alle anderen Farben sind Zwischenstufen von hell und dunkel , er begründet dies mit der Aussage ,dass das Mischen aller Farben einen Grauton ergibt.
Aufbau der Farbenlehre
Goethes Farblehre besteht aus drei Teilen:
- Didaktischer Teil (Entwurf einer Farbenlehre)
- Polemischer Teil (Enthüllung der Theorie Newtons)
- Historischer Teil (Materialien zur Geschichte der Farbenlehre)
Im ersten Teil, dem didaktischen, ging es Goethe zunächst darum, die Naturerscheinung "Farbe" auf ihre Anwendungsmöglichkeiten als Kunstmittel zu untersuchen. Goethe unterschied "Physiologische", "Physische" und "Chemische" Farben, untersuchte die Wirkung der Farben auf das "Sinnlich-Sittliche", damit ist die Wirkung auf die Sinne und auf den Gemütszustand des Menschen gemeint . Die "Physiologischen Farben" stellte Goethe an die Spitze seines Werkes, weil sie "das Fundament der Lehre ausmachen". Aufschlussreich sind Goethes Versuche mit dem Prisma, die zur Ableitung eines Farbschemas führten, das er für alle Farbenerscheinungen gültig erklärte. Es besteht aus den Elementarfarben Gelb - Orange - Rot (Purpur) - Violett - Blau - Grün. Goethe versuchte dem Farbenspektrum Newtons die einfache Erscheinung der Farbenentstehung, als "Urphänomen" bezeichnet, entgegenzusetzen. Er fand es in folgender Wahrnehmung: In Verbindung mit Hell und Dunkel erscheint dem Auge in einem trüben Mittel entweder die Farbe Gelb (vor hellem Hintergrund) oder die Farbe Blau (vor dunklem Hintergrund). In diesem "Urphänomen" offenbarte sich Goethe auch die "Polarität" der Natur, die für ihn ein Grundgesetz, ein "Triebrad" der Natur war. Auf das "Urphänomen" versuchte er alle physischen Farberscheinungen zurückzuführen. Die übrigen Farben des Farbschemas entwickelten sich für Goethe durch "Steigerung" der Urfarben Gelb und Blau, durch Mischung und Vereinigung. "Steigerung" sah er als zweites "Triebrad" der Natur an.
Im "Polemischen Teil" ging Goethe zu einem Frontalangriff gegen Newtons Farbentheorie über. Goethes Farbenlehre ist weniger eine physikalische Theorie der Beschreibung des Wesens des Lichts, als vielmehr eine Theorie der Sinneswahrnehmung von Licht und Farben. Die Physik erklärt nicht, wie die Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge im menschlichen Auge in rot, blau und gelb umgesetzt wird. Das ist Gegenstand der Sinnesphysiologie und darauf hat Goethe hingewiesen.
Der "Historische Teil" der "Farbenlehre" wurde als letzter abgeschlossen und trägt den Titel "Materialien zur Geschichte der Farbenlehre". Diese "Geschichte der Farbenlehre" ist der großangelegte Entwurf einer allgemeinen Wissenschaftsgeschichte von der "Urzeit" bis zur Gegenwart.
Goethes Theorie von den Farben
''Beim Betrachten der Umwelt und dieser Karten lässt sich feststellen, dass die Bilder durch das Prisma verschoben werden, die parallel zur Kante des Prismas verlaufenden Linien gebogen erscheinen, alle Grenzen zwischen Hell und Dunkel einen farbigen Rand erhalten, außer die genau senkrechten und einfarbige Flächen in ihrem Inneren keine anderen Farben besitzen. Aus dem nun folgenden Versuch , wo er eine schwarze Fläche mit einem hellen Streifen und eine helle Fläche mit einem schwarzen Streifen , durch ein Prisma beobachtet hat , hat er seine Theorie des heutigen Farbkreises abgeleitet .,,
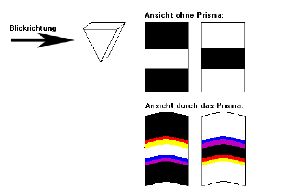 Abbildung
1: Goethes Grundexperiment
Abbildung
1: Goethes Grundexperiment
Ergebnis des ersten Versuches , war eine Blau-Violette Grenze erscheint , wenn das Schwarze überwiegt , ebenso eine Rot-Gelbe Grenze wenn das Weiße überwiegt , wie in Abb. 1 zusehen ist . In dem erweiterten Experiment hat Goethe einen schmaleren Streifen genommen und den Abstand des Blickpunktes zum Prisma vergrößert . Die Verkleinerung der Abstände der oberen und unteren Kanten , bewirkten ein annähern von Blau und Gelb und erzeugten Grün . Zum anderen entsteht Purpur durch Mischung von Violett und Rot für den rechten Fall.
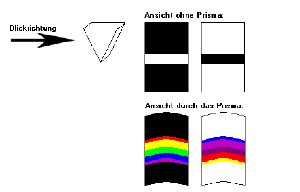 Abbildung
2: Erweitertes Grundexperiment
Abbildung
2: Erweitertes Grundexperiment
Das Farbspektrum das Goethe erhalten hat wird im linken Teil deutlich . Der rechte Teil zeigt ein aus dem schwarzen Streifen entstandenes ,,negatives Spektrum" als die Umkehrung des vorherigen Falls . Die sechs gefundenen Grundfarben Blau, Violett, Purpur, Gelb-Rot, Gelb und Grün bilden den Farbkreis (Abb. 3).
Abbildung 3: Der Goethesche Farbenkreis
Nach Meinung Goethes sind Schwarz und Weiß keine
Farben und daher für Goethe auch nicht die Urpolarität , diese ist für ihn
aus dem Gegensatz zwischen Blau und Gelb in dem Grundexperiment entstanden , d.h
das alle Farben aus einer Steigerung von Blau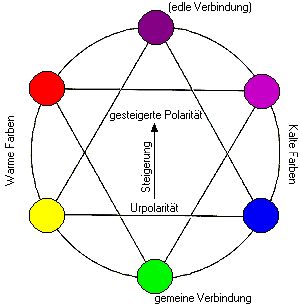 und Gelb gebildet werden können .
Das Gesetz von der Polarität stellte für Goethe eines seiner drei Grundgesetze
der Natur dar. Andere Beispiele dafür sind die Gegensätze zwischen positiv und
negativ geladenen Teilchen und dem Nord - und dem Südpol . Der Unterschied
zwischen den drei genannten Gegensätzen und den Farben ist allerdings der, dass
es sich im hier behandelten Fall um eine qualitative Polarität handelt. Als
einfachste Möglichkeit der Entstehung einer neuen Farbe aus der Urpolarität
findet sich in der Bildung von Grün durch eine Mischung von Blau und Gelb. Das
zweite Grundgesetz war für Goethe das der Steigerung , wobei durch die
Steigerung der Urpolarität Blau und Gelb alle anderen Farbsequenzen entstanden
sind . Das dritte Grundgesetz war das der Totalität, ist das Auge nur einer
bestimmten Farbe ausgesetzt , strebt es nach der Allgemeinheit und sucht die
Gegenfarbe dazu , diese wird in einem harmonischen Bild gesehen
und Gelb gebildet werden können .
Das Gesetz von der Polarität stellte für Goethe eines seiner drei Grundgesetze
der Natur dar. Andere Beispiele dafür sind die Gegensätze zwischen positiv und
negativ geladenen Teilchen und dem Nord - und dem Südpol . Der Unterschied
zwischen den drei genannten Gegensätzen und den Farben ist allerdings der, dass
es sich im hier behandelten Fall um eine qualitative Polarität handelt. Als
einfachste Möglichkeit der Entstehung einer neuen Farbe aus der Urpolarität
findet sich in der Bildung von Grün durch eine Mischung von Blau und Gelb. Das
zweite Grundgesetz war für Goethe das der Steigerung , wobei durch die
Steigerung der Urpolarität Blau und Gelb alle anderen Farbsequenzen entstanden
sind . Das dritte Grundgesetz war das der Totalität, ist das Auge nur einer
bestimmten Farbe ausgesetzt , strebt es nach der Allgemeinheit und sucht die
Gegenfarbe dazu , diese wird in einem harmonischen Bild gesehen
Abbildung 4: Harmonische Farbenpaare
 Die
Farbeinheiten Violett - Rot und Grün werden als positives Spektrum oder warme
Farben bezeichnet , ebenso Gelb - Blau und Purpur als negatives Spektrum oder
kalte Farben .
Die
Farbeinheiten Violett - Rot und Grün werden als positives Spektrum oder warme
Farben bezeichnet , ebenso Gelb - Blau und Purpur als negatives Spektrum oder
kalte Farben .
Additive und subtraktive Farbmischung (olli)
Die Mischung der Farben unterliegt nun bestimmten Gesetzen, je nachdem, ob wir es mit farbigen Licht oder Farbsubstanzen ( Körperfarben ) zu tun haben. Die zwei wesentlichen sind die additive und subtraktive Farbmischung, die im folgenden erklärt werden.Die Additive Farbmischung
Die Farbmischung entsteht, wenn Licht unterschiedlicher
Wellenlänge auf gleiche Punkte der Netzhaut fällt. Das heißt also, das wir es
mit farbigem Licht zu tun haben, das aus den drei
Grundfarben Blau, Rot und Grün besteht. Je nach Intensität, mit der die drei
Primärfarben ausgestrahlt werden, ergeben sich die restlichen Farben als
Mischung. Aus Rot mit Grün, entsteht Gelb, aus Grün und Blau entsteht Cyan und
aus Blau und Rot wird Magenta. Werden die drei Farben in gleicher Intensität überlappend
ausgestrahlt, so entsteht der Farbeindruck Weiß. Hieraus resultiert auch die
Beschreibung "RGB-Farbsystem".
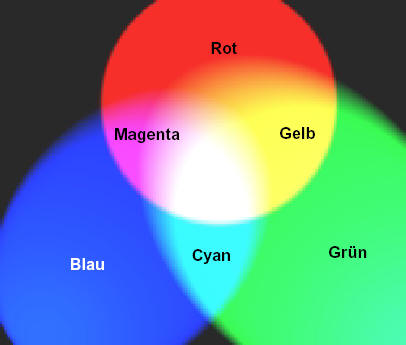
Anwendung:
Die Additive Farbmischung tritt nur bei selbstleuchtenden Körpern auf, zum
Beispiel die Bildröhren bei einem Fernseher oder Monitor.
Beispiel: Farbmischung bei Farbfernsehen
Das Bild besteht hier aus drei Teilbildern, die zusammenaddiert, das farbige
Bild entstehen lassen. In der Kamera existieren dafür drei Aufnahmesysteme, die
das Bild durch unterschiedliche Filter aufnehmen. Wenn die Kamera ein Bild
aufnimmt, wird es in die drei Teilbilder zerlegt, die auf der additiven
Farbmischung basieren und vom Gegenstand reflektiert bzw. durchgelassen werden.
Diese Teilbilder werden nun von der Sendestation Punktweise gesendet. Dies
geschieht mit Hilfe von elektrischen Signalen, die vom Sender zum Empfänger ( in
unserem Fall der Fernseher ) übertragen werden. In der Bildröhre befinden sich
nun drei Elektronenstrahle, für jeden der additiven Grundfarben einen, die auf
den Bildschirm gerichtet sind, der mit kleinen Punkten bedeckt ist, die in einem
Dreieck angeordnet sind, in dem jede Farbe nur einmal vorkommt, welche aus einem
speziellen Leuchtstoff bestehen. Wird ein Elektronenstrahl nun aktiviert und
trifft auf die mit Punkten bedeckte Schicht, leuchten die Punkte auf, die zu dem
Elektronenstrahl zugehörig sind. Wenn nun das Signal des Senders eintrifft,
werden die Strahlen mit Hilfe einer Spule abgelenkt, so das sich die Strahlen
zeilenweise über den Bildschirm bewegen. Damit aber die richtigen Farbpunkte
getroffen werden, müssen die Strahlen vorher noch durch eine Lochmaske, die vor
dem Bildschirm liegen. Da jeder Strahl einen anderen Eintrittswinkel besitzt,
wird immer der richtige Punkt getroffen und beleuchtet. Da das Auge nicht in der
Lage ist, die einzelnen Bildpunkte zu unterscheiden, entsteht so ein
ganzheitliches Bild im Gehirn. Durch unterschiedlich stark leuchtende
Bildpunkte, entstehen auch unterschiedlich helle bzw. dunkle Flächen.
Die subtraktive Farbmischung
wir versuchen das oben genannte Prinzip nun auf einen Tuschkasten anzuwenden. Würden wir die drei Grundfarben mischen, so würden wir schnell merken, das nicht Weiß, sondern Schwarz entsteht. Das liegt daran, das die Pigmente in Tuschkasten nicht selber leuchten, sondern nur Licht bestimmter Wellenlänge absorbieren bzw. reflektieren.
Eine Farbsubstanz, die kurzwelliges Licht ( blau ) absorbiert, reflektiert lang- ( Rot ) und mittelwelliges ( Grün ) Licht und erscheint deshalb als Gelb. Bei mittelwelliger Absorption werden lange und kurze Wellen reflektiert und es entsteht der Farbeindruck Magenta ( blaurot ). Bei langwelliger Absorption wird also Cyan sichtbar ( Blaugrün ).
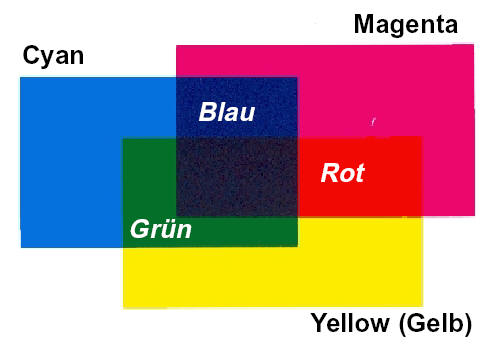
Von diesen drei Sekundärfarben wird bei der subtraktiven Farbmischung ausgegangen. Gemischte Farbsubstanzen absorbieren mehrere Wellenlängen des Lichtes und reflektieren Mischfarben, die dunkler als die drei Grundfarben erscheinen. Die Leuchtkraft der Farben nimmt bei der Mischung ab, deshalb auch der Name subtraktive Farbmischung. Werden alle drei Farben in voller Sättigung aufgetragen, entsteht der Farbeindruck Schwarz.
Anwendung:
Die subtraktive Farbmischung findet Anwendung bei Wiedergabe eines Bildes auf
ein Medium, wie z.B. Papier, wobei das Bild eine längere Zeit erhalten bleiben
soll.
Beispiel: Farbdruck und Farbfotographie
Damit es zum Farbdruck kommen kann, muss zuerst das Bild fotografiert werden.
Hierbei wird das Bild durch spezielle Filter aufgenommen, wobei jede Farbe
einzeln aufgenommen wird. Schwarz wird extra aufgenommen, um ein reines Schwarz
wiedergeben zu können, da bei der Mischung der drei Sekundärfarben ein meist nur
braunes Schwarz entsteht. Gleichzeitig wird die Vorlage noch in Bild- und
Rasterpunkte aufgeteilt. Nun werden für jede Farbe Druckplatten
hergestellt. Dann beginnt man die Farbe in der Reihenfolge Cyan, Gelb, Magenta
und Schwarz mit Hilfe der Druckplatten auf ein weißes Blatt Papier aufzutragen.
Hierbei sind die gedruckten Bild- und Rasterpunkte so klein, dass das
menschliche Auge sie nicht mehr unterscheiden kann und eine bunte Fläche
wahrnimmt.
Bei der Farbfotografie verläuft es so ähnlich. Das Bild wird auch in drei
Teilbilder zerlegt. Jedoch gibt es einen unterschied. Bei der Farbfotografie
wird das Negativ belichtet und das Bild trifft auf ein speziell beschichtetes
Papier. Dieses Papier hat drei Schichten, wobei die oberste Schicht auf blaues
Licht, die zweite auf grünes Licht und die dritte Schicht auf Rot reagiert. Wenn
das Negativ nun entwickelt wird, entsteht die Komplementärfarbe des Lichtes auf
dem Negativ. Die blaue Schicht erzeugt gelbe Farbe, die Grüne erzeugt die Farbe
Purpur und die rote Schicht erzeugt eine blaugrüne Farbe.
Enthält ein Bild nur zwei der drei Grundfarben, reagieren nur zwei der drei
Schichten, bei weißem Licht reagieren alle Drei Schichten, da es alle Farben
enthält. Schaut man sich also ein Negativ an, so sieht man das Komplementärbild
des Originals. Das Fotopapier hat nun den selben schichtweise Aufbau wie das
Negativpapier. Wird das Negativ nun wieder auf das Fotopapier abgelichtet,
entsteht das Bild in seinen Originalfarben, das so genannte Positiv.
Quellen: