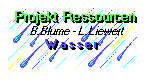| Projekte | Ressourcen | ||||
| Projektvorstellung | Plankton Schlei | Plankton Ostsee | Wasseruntersuchungen | Ergebnisse Schlei | |
| Ergebnisse Kieler Förde | Brief an den Bundeskanzler | Die Antwort des Kanzlers | Schulen | ||
|
|
Vergleich der Wasserqualität der Schlei mit der Kieler FördeIngo Wolff |
| Praktische Untersuchungen in der
großen Breite der Schlei (Borgwedel) und
der Kieler Förde (Friedrichsorter Bucht) zeigen, daß die Wasserqualität
an der Küste der Ostsee sich bei geringer werdendem Wasseraustausch
deutlich verschlechtert. Der Biologieleistungskurs (13. Jahrgang)
der Integrierten Gesamtschule Friedrichsort IGF führte zur Überprüfung
der Hypothese Untersuchungen durch. Die Untersuchungen lassen sich in drei Bereiche gliedern: · Vegetationsuntersuchungen in Litoral- und Uferbereich · Planktonuntersuchungen · Chemisch-physikalisch-bakteriologische Wasseruntersuchungen. Die Untersuchungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. |
| 1. Vegetationsuntersuchungen Im Litoralbereich der Schlei: Es gibt keine Pflanzen in der Tauch- und Schwimmblattzone. Im nicht zu stark dem Wind ausgesetzten oder durch den Menschen genutzten Uferabschnitten ist ein dichter Schilfgürtel mit anschließender dichter Verlandungsvegetation zu finden. Wertung: Das völlige Fehlen von Pflanzen in der Tauchblattzone (Seegras, Braunalgen, Wasserpest, krauses Laichkraut) weist auf eine sehr schlechte Eindringtiefe des Lichtes in das Wasser hin. Das Fehlen von Pflanzen in der Schwimmblattzone (schwimmendes Laichkraut, Seerose, Teichrose) lassen die Vermutung auftauchen, daß der Salzgehalt der Schlei für die Pflanzen zu hoch ist. Der dichte Schilfgürtel und die dichte Verlandungsvegetation weisen auf ein nährstoffreiches Sediment hin. Im Litoralbereich der Ostsee (Falkensteiner Strand) sind Seegras im Sandbereich bis in cirka vier Meter Tiefe und Braunalgen (Blasentang) auf den Steinen zu finden. Im nicht zu stark beeinflußten Uferbereich sind Sandquecken und Strandhafer auf sich bildenden kleinen Sanddünen zu finden. |
| 2. Planktonuntersuchungen In der Schlei dominieren in einer sehr hohen Dichte Blaualgen und Goldalgen. In der Friedrichsorter Bucht hingegen in einer viel geringeren Dichte Diatomeen (Kieselalgen) und Dinophyceen (Dinophlagellaten). Der Vergleich der vollständigen Ergebnisse zeigt, daß das Plankton in der Friedrichsorter Bucht artenreicher ist, wobei pro Art die Individuenanzahl viel geringer ist. Die hohe Blaualgendichte in der Schlei, man kann hier von einer Blaualgenblüte sprechen, weist auf eine hohe Nährsalzbelastung des Wassers hin. Das Plankton der Kieler Förde gibt keine Hinweise auf eine Gewässerbelastung. |
| 3. Chemisch-physikalisch-bakteriologische
Gewässeruntersuchungen In der Schlei wurde nur eine sehr geringe Sichttiefe des Wassers vorgefunden. Bei einer einheitlichen Temperatur zirkuliert das Wasser bis zum Grund. Trotzdem nimmt der Sauerstoffgehalt bereits in zwei Meter Tiefe auf die Hälfte ab. Der hohe pH-Wert (8,9) zeigt eine hohe Photosyntheserate. Da der pH-Wert auch in drei Meter Tiefe noch hoch ist, kann auf einen unvollständigen Abbau organischer Substanzen geschlossen werden. Bei den Nährsalzgehalten ist auffällig, daß nur Phosphat frei im Wasser gelöst in nennenswerter Konzentration auftritt. Untersuchungen des Wasseranteils im Sediment (Interstitiallösung) zeigen aber einen hohen Gehalt an Stickstoffverbindungen. Es ist daher zu vermuten, daß die Stickstoffverbindungen im freien Wasser fast vollständig von Lebewesen aufgenommen worden sind. Die hohe Keimzahl gibt einen Hinweis auf eine intensive Zersetzungstätigkeit, die aber keineswegs ausreicht, um alle abgestor-benen Planktonlebewesen abzubauen.Schließlich wurde eine dicke schwefelwasserstoffhaltige Faulschicht nachgewiesen. Der biochemische Sauerstoffbedarf weist auf ein Gewässer der Güteklasse 3 hin (1= sehr gut - 4=stark belastet). Der Salzgehalt ist im Vergleich zu der westlichen Ostsee sehr niedrig. |
| Wertung: Alle Daten der Schlei weisen auf ein stark belastetes Gewässer hin, Untersuchungen des Wassers eines sich durch die Felder windenden Baches zeigen, daß die Ursache der Belastung auch in Dünger - und Fäkalieneinleitungen liegen. In der Friedrichsorter Bucht weisen alle Daten von 0 - 12 Metern auf ein intaktes Gewässer hin, das heißt, freie Nährsalze liegen unter der Nachweisgrenze, der pH-Wert liegt nur knapp über 7. Es liegt allerdings bei nicht vorhandener Sprungschicht Sauerstoffsättigung oder Übersättigung vor. Der BSB5 weist auf eine Wassergüteklasse 1 hin. Der Salzgehalt entspricht dem mittleren Salzgehalt der westlichen Ostsee. Ein deutlich anderes Ergebnis erhält man bei den Sedimentuntersuchungen. In der Interstitiallösung werden relativ hohe Ammonium- und Nitratkonzentrationen und extrem hohe Phosphatgehalte neben reichlich Schwefelwasserstoff gefunden. |
| Beurteilung der Ausgangshypothese Im Schleiwasser zeigt der niedrige Salzgehalt, daß der Wasseraustausch über die enge Schleimündung nur sehr begrenzt erfolgt. Durch menschliche Einflüsse (Zuckerfabrik, unzureichende Klärwerke, Düngung) belastetes Süßwasser führt zu einer Überdüngung und Eutrophierung (Oligotroph = unbelastetes, intaktes Gewässer, Eutroph = nährsalzreicheres Gewässer, Polytroph = extrem nährsalzreiches, stark belastetes Gewässer, Eutrophierung ist der Weg vom intakten Gewässer zum belasteten Gewässer durch Einleitungen). In der Friedrichsorter Bucht geben die Sedimentuntersuchungen Hinweise auf eine stark vom Menschen verursachte Nährsalzbelastung (Phosphate durch die Friedrichsorter Werften ??? Rostumwandler ???). Andererseits ist die Wasserqualität selbst gut, die Ursache dafür ist in dem ständig stattfindenden Wasseraustausch über die Belte zu suchen. Würde man die Friedrichsorter Enge über einen Damm zuschütten, würde sich die Wasserqualität in Kürze drastisch verschlechtern. |
| Weitere Planung Die Untersuchungsergebnisse werden zusammengefaßt, jährlich erneuert und ausgewertet/bewertet und im Internet auch auf den Seiten der Unesco-Modellschulen veröffentlicht. Die Untersuchungen werden auf die Fließgewässer der Umgebung ausgedehnt und von Schülern des 13. Jahrganges weitergeführt. |