|
Während die Verwendung der Erdwärme zur Elektrizitätserzeugung auf
längere Sicht auf besonders begünstigte Stellen beschränkt bleiben
wird, kann die Verwendung als Primärenergie im breiteren Rahmen
vorangetrieben werden, wenngleich Gebiete mit erhöhtem Wärmefluß auch
hier natürlich die günstigeren Voraussetzungen bieten. Diese
Verwendungsart wird dem Charakter der geothermalen Energie mit relativ
niedrigen Ausgangstemperaturen am ehesten gerecht. Der Abnehmer muß
sich in nächster Nähe befinden: ein längerer Transport als 5 km wird
heute nicht als rentabel angesehen.
Man kann hierbei die Wärme natürlich herausfließender oder durch
Bohrungen erschlossener Thermalwässer verwenden, oder aber, wie beim
Projekt "heißes trockenes Gestein" Wasser zwecks Erwärmung
in den Untergrund hineinbringen. Bei der ersten Methode besteht aber
auch der Nachteil, eher von den Wassermengen als von den Wärmevorräten
abhängig zu sein.
Diese Wässer sind für folgende Zwecke nutzbar:
a) Heizung
b) Warmwasserversorgung
c) Gewächshäuser
d) Bewässerung
geordnet nach Abnahme der benötigten Temperatur.
In zwei europäischen Ländern wird die geothermale Energie für diese
Zwecke in größerem Rahmen genutzt, in Island und in Ungarn. Beide
Gebiete, vor allem natürlich Island, zeichnen sich durch erhöhten Wärmefluss
aus. In Reykjavik werden etwa 87% der Häuser mit
Heißwasser aus einem geothermischen Feld versorgt, das Wasser von 128°
C liefert. Auch Provinzstädte in Island haben ähnliche kombinierte
Heiz- und Warmwasser-Anlagen. Nahezu die Hälfte der isländischen
Bevölkerung heizt mit Erdwärme. Daneben gibt es ausgedehnte Nutzung
für industrielle Zwecke und Gewächshäuser, die einen sehr wichtigen
Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Frischgemüse und -Obst
leisten.
Während in Island als vulkanisches Gebiet diese Energiemengen
natürlich erwartet werden können, ist es zunächst überraschend, dass
auch unter der Ungarischen Tiefebene, fern den heutigen Vulkanen, große
geothermale Energiereserven vorhanden sind. Sie werden zielstrebig
genutzt, indem durch Tiefbohrungen gefördertes Wasser, also praktisch
fossiles Thermalwasser, verwendet wird. Besonders in Südungarn ist
diese Nutzung intensiv, wenn sie auch prozentual nicht so sehr ins
Gewicht fällt. Angestrebt wird eine vierstufige Nutzung, d. h. ein
einmal gefördertes Thermalwasser wird allen vier Verwendungsarten in
der oben genannten Reihenfolge nacheinander zugeführt. Dies
gewährleistet eine volle Ausnützung des Bodenschatzes, wird aber meist
auch nicht konsequent durchgeführt; man begnügt sich gewöhnlich mit
der Ausnützung von ein bis zwei dieser Verwendungsmöglichkeiten an
einem Ort.
Außer diesen Ländern wird geothermale Primärenergie in der ehemaligen
UdSSR, Japan und Neuseeland intensiver, aber mehr in lokalem Rahmen
genutzt. In Österreich werden schon seit langem die warmen Quellen
entlang der "Thermallinie" im Wiener Becken, zum Beispiel in
Baden und Bad Vöslau (36 Grad Celsius), zu Kurzwerken ausgenutzt. In
Deutschland gibt es noch eine wesentlich wärmere Quelle in Baden-Baden
mit 67 Grad Celsius. Ansonsten finden wir in der BRD noch andere
geothermische Anomalien - also ungewöhnlich warmen Boden - in der
Gegend von Urach und Landau.
Die Elektrizitätserzeugung aus Erdwärme wirft nicht
unbeträchtliche Umweltprobleme auf. Am wenigsten noch das Projekt
"heißes trockenes Gestein". Hier bedeuten Sprengung und
Abkühlung in der Tiefe eine gewisse Erdbebengefahr, die allerdings
nicht hoch eingeschätzt werden muss. Besondere Probleme erwachsen bei
den Kraftwerken, die heißes Wasser aus dem Untergrund fördern. Diese
enthalten oft in großer Menge gelöste Salze, oft in weit höherer
Konzentration als im Meerwasser. Auch noch bei der Verwendung einer
2%-iger Salzlösung würde ein 1000 MW Kraftwerk täglich 12 000 t Salz
mitfördern. Die häufige Beimischung anderer Substanzen wie Bor erhöht
die Schwierigkeit der Beseitigung. Entweder muss das Wasser vor der
Ableitung entsalzt werden, oder es muss durch Bohrlöcher wieder in die
Tiefe versenkt werden. Diese Methode, die derzeit verbreitet ist, trägt
dazu bei, das Umweltproblem möglicherweise gefährlicher
Bodensenkungen, die durch die Wasserentnahme hervorgerufen werden
könnten, zu vermeiden. Die Korrosionswirkung aggressiver Lösungen ist
auch für den Betrieb ein Problem.
Manche dieser unterirdischen Wässer enthalten auch gelöste oder freie
Gase, die nicht immer harmlos sind. Gerade Schwefelwasserstoff, der sich
in Wasser löst, lässt sich nur schwer abtrennen, da er erst bei der
Verdampfung des Wassers bei der Abkühlung frei wird. Dem Kraftwerk The
Geysers entweicht z. B. so viel Schwefel, als würde es Öle mit
niedrigem Schwefelgehalt verbrennen. Die Schwefelemissionen müssen also
begrenzt werden; dies könnte übrigens ein Anreiz sein, die Entwicklung
der Kraftwerke mit Sekundärflüssigkeit voranzutreiben, da hier die
Emissionen leichter zu kontrollieren sind.
Es ist also klar, dass geothermische Kraftwerke nicht so
umweltfreundlich sind wie Sonnen- oder Windkraftwerke, man kann aber
doch sagen, dass diese Probleme beherrscht werden können und der
Nutzung nicht entgegenstehen dürfen.
Voraussetzungen für Nutzung der Geothermie sind '"sehr
begrenzt"
Der mittelfristig erzielbare Anteil der Geothermie am Energieverbrauch
in Deutschland ist auch bei einer Steigerungsrate von über zehn Prozent
pro Jahr "äußerst gering". Dies habe eine entsprechende
Analyse ergeben, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion.
Derzeit existierten in Deutschland 18 hydrogeothermale Heizzentralen,
die natürlich vorhandene, heiße Tiefenwässer nutzen, mit einer
thermischen Leistung von rund 50 Megawatt. Erdgekoppelte Wärmepumpen
seien nicht eingerechnet.
Die Bundesregierung hält die geologischen Voraussetzungen zur Nutzung
der hydrothermalen Erdwärme hierzulande für "sehr begrenzt".
"Gewisse Nutzungsmöglichkeiten" bestünden im süddeutschen
Molassebecken und in der norddeutschen Tiefebene. Die Ressourcen seien
"weitgehend ermittelt". Derzeit noch bestehende
Forschungsdefizite wie etwa Fragen des hohen Salzgehaltes oder
bakterielle Verunreinigungen und chemische Reaktionen im Aquiferbereich
würden durch Projekte aufgearbeitet.
Zur Hot-Dry-Rock-Technologie erklärt die Bundesregierung, dieses
Verfahren befinde sich selbst nach 20 Jahren weltweiter Untersuchungen
noch immer "eindeutig" im Forschungsstadium. Von der Mitarbeit
in einem neuen Gremium der Internationalen Energie-Agentur zum Thema
Geothermie verspricht sie sich keinen zusätzlichen Gewinn.
Die Bundesregierung betont, sie habe die Geothermie in den letzten
Jahren stets mit rund 5 Millionen DM gefördert. Im vergangenen Jahr
seien jedoch förderungswürdige Projektanträge nur in einem Volumen
von rund 4, 8 Millionen DM gestellt worden. Von einer Kürzung der
Fördermittel für die Geothermie "kann also nicht die Rede
sein", heißt es in der Antwort.
In Zeiten zunehmender Erwärmung des Erdklimas wird verstärkt nach
Energieformen gesucht, die nicht zum Treibhauseffekt beitragen. Eine Möglichkeit
der Wärmegewinnung ohne zusätzliche Emission von
Treibhausgasen ist die Erdwärme.
Am Geo-ForschungsZentrum (GFZ) arbeitet unter der Leitung von Dr. Ernst
Huenges eine Projektgruppe aus Geowissenschaftlern, Ingenieuren und
Energiewirtschaftlern. Ziel des Projektes ist die Bewertung der
geowissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Nutzung
hydrothermaler Lagerstätten. Die Gewinnung thermischer Energie aus
warmen Wässern des Tiefenbereiches 1000-2500 m Mittel- und
Norddeutschlands kann bei breiter Anwendung einen erheblichen Beitrag
zur Reduzierung der CO2- Emission liefern. Das Vorhaben wird vom
Bundesforschungsministerium mit 3,6 Mio. DM zunächst für die Dauer von
3 Jahren gefördert.
Außerhalb des GFZ betreibt die Projektgruppe einen Standort in
Neubrandenburg. Der Platz ist nicht zufällig gewählt worden: in dieser
Region bestehen langjährige Erfahrungen in der Nutzung dieser Energie.
Bereits im Betrieb befindliche Anlagen bestätigen die prinzipielle
Anwendbarkeit des Verfahrens. Untersuchungsschwerpunkt der Projektgruppe
wird die Betrachtung geowissenschaftlicher und geochemischer Aspekte des
Langzeitverhaltens derartiger Geothermie-Anlagen in Hinblick auf eine
verfahrenstechnische Optimierung sein. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
und Umweltverträglichkeitsstudien sollen die zu schaffenden
Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser Technologie klären.
Im Jahr 1970 stieß man in Bad Urach in 769 m Tiefe auf 58 C heißes
Wasser, das heute zu heiltherapeutischen Zwecken genutzt wird. In der
Folgezeit wandte sich die Forschung aber verstärkt der im trockenen
Gestein enthaltenen Wärme zu. Bei der Bohrung Urach 3 fand man in einer
Tiefe von 3.500 m eine Temperatur von 147 C vor und in 4.444 m 170 C
(1993). Die Temperaturen waren höher als für diese Tiefe erwartet.
Für die Nutzung der Erdwärme also ein idealer Ort, da mit zunehmender
Tiefe die Bohrkosten überproportional ansteigen.
Die Errichtung einer Demonstrationsanlage wird sehr kostspielig sein,
deshalb wird z.Z. innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ein
gemeinsamer Standort gesucht. Bad Urach und zwei weitere Standorte
stehen in der engeren Wahl. Bei diesem Projekt soll nach dem
Hot-Dry-Rock-Verfahren (HDR: heißes, trockenes Gestein) die Wärme
nutzbar gemacht werden. Das Prinzip klingt einfach. Es wird eine
Tiefbohrung niedergebracht und durch Einpressen von Wasser mit
Überdruck (hydraulisches Brechen) entsteht ein künstliches Klüfte-
und Spaltensystem. Insgesamt bilden diese Systeme eine große
Oberfläche aus, so dass sie als künstliche Wärmetauscher genutzt
werden können. Eine zweite Bohrung wird in das Risssystem niedergebracht. Nun wird kaltes Wasser ins erste Bohrloch
gepresst, beim
Durchströmen des Risssystemes erwärmt und über die zweite Bohrung als
Heißwasser gefördert. Geologisch-technisch gesehen ist das Aufbrechen
großer Spaltsysteme mit mehreren Quadratkilometern
Wärmetauscherfläche schwierig.
In Bad Urach führte man u.a. Versuche mit einem Einrohrsystem durch.
Eine Vielzahl weiterer Tests beschäftigten sich mit der Stimulierung
von hydraulischen Fließwegen und der Beschaffenheit der
Gesteinsschichten, um Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit zu
erlangen. Sollten sich die in das HDR-Verfahren gesteckten Erwartungen
in 10-15 Jahren erfüllen, könnte die terrestrische Energie in
Kraftwärmeanlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden.
Quellen: Pressezentrum des Deutschen Bundestages,
GeoForschungsZentrum (GFZ) ?
|
24159
Kiel-Friedrichsort * Steenbarg 10 |
|
 0431-399023-10 0431-399023-10 |
 0431-399023-40 0431-399023-40 |
 wolff@igfsek2.de wolff@igfsek2.de |
|
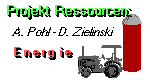 Geothermische Kraftwerke
Geothermische Kraftwerke

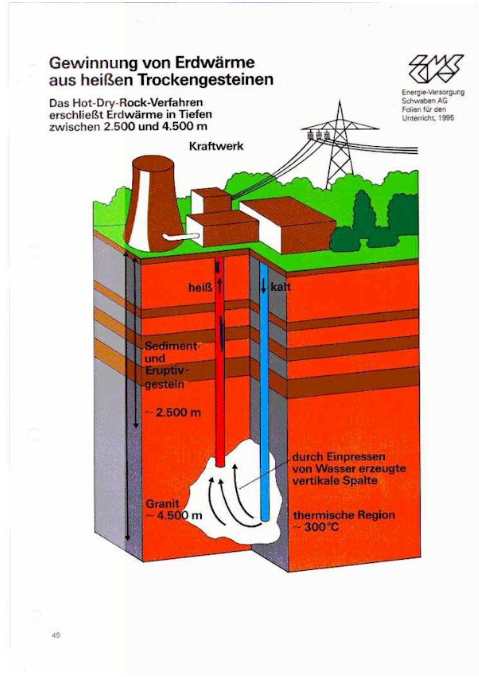
 wolff@igfsek2.de
wolff@igfsek2.de